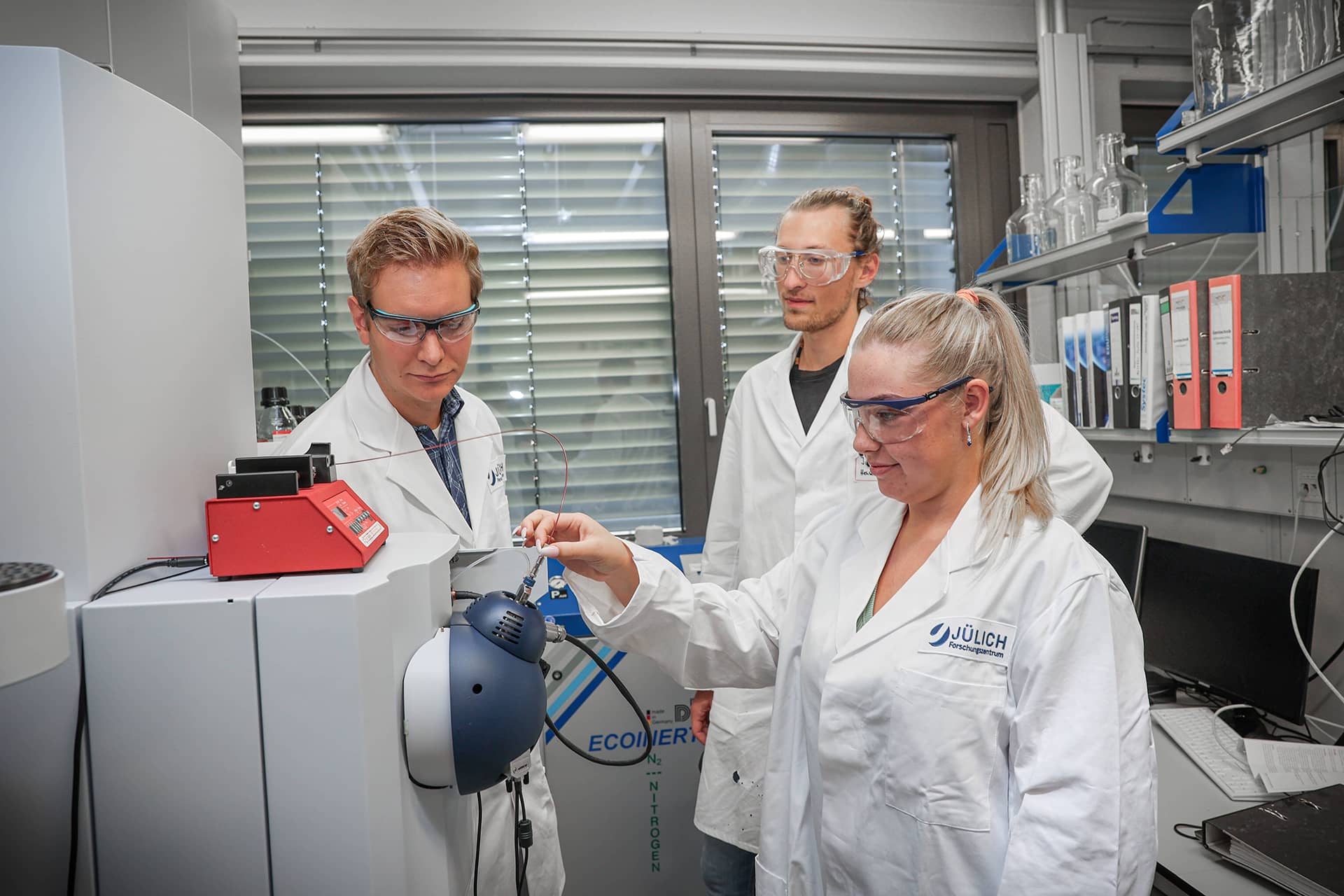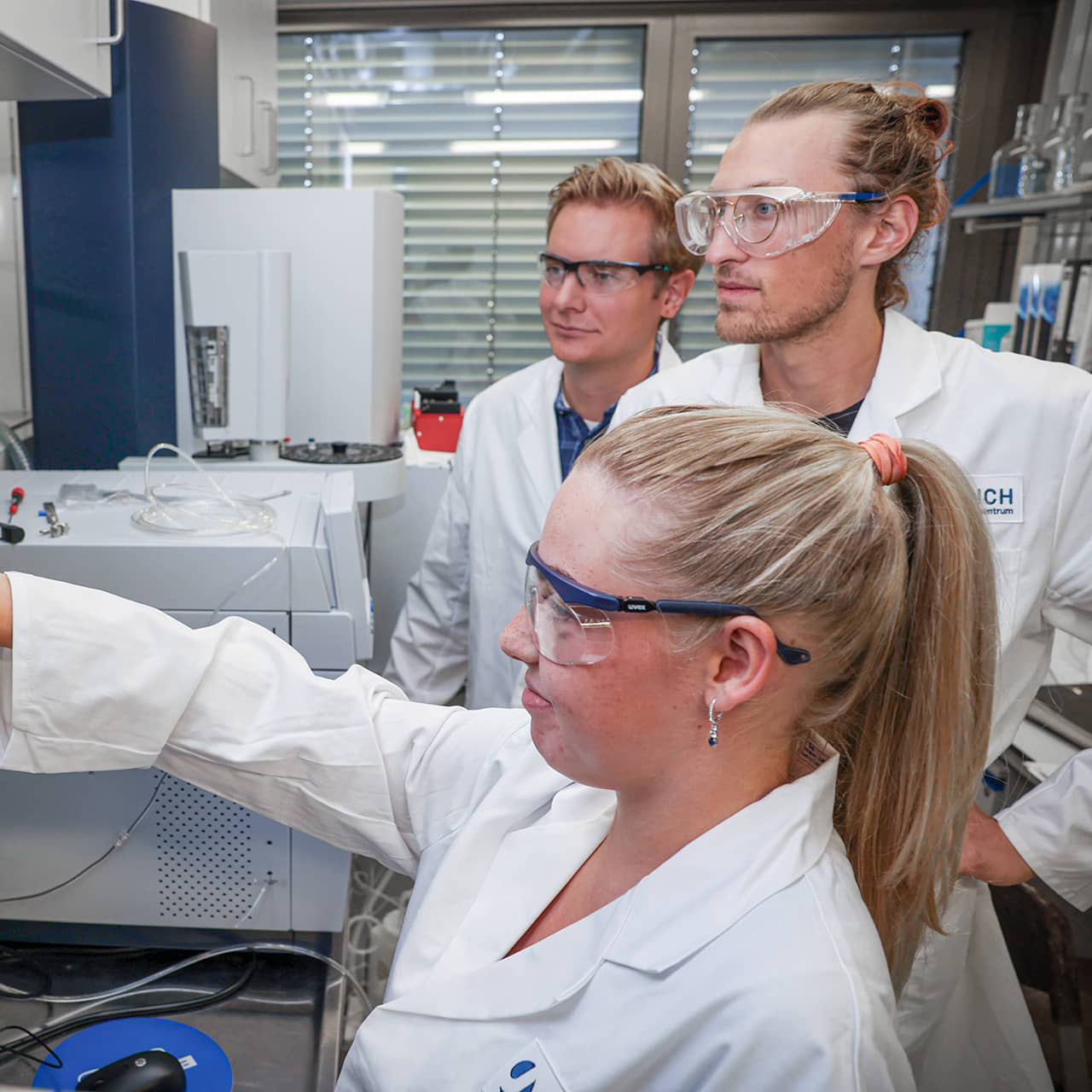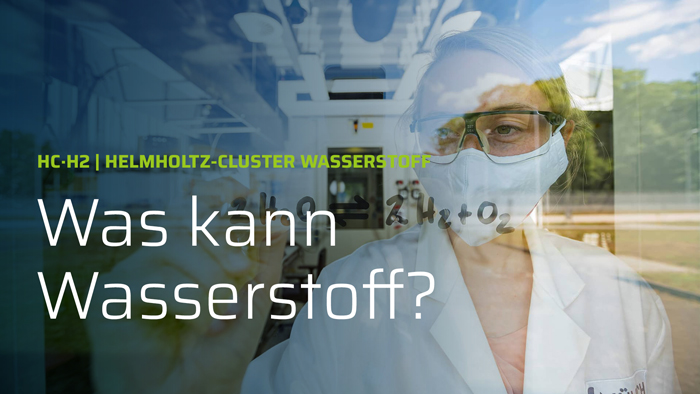Das Helmholtz-Cluster für nachhaltige und infrastrukturkompatible Wasserstoffwirtschaft HC-H2 hat zwei große Ziele: Zum einen wollen wir einen Beitrag im Kampf gegen den Klimawandel leisten. Wir wollen zeigen, wie wichtig und alltagstauglich Wasserstoff als Klima-neutraler Energieträgerer sein kann, damit die Welt auf das Verbrennen von fossilen Energieträgern wie Kohle, Öl oder Gas verzichten kann.
Zweitens wollen wir ein wichtiger Teil der Lösung für den Strukturwandel im Rheinischen Revier sein. Der Strukturwandel läuft schon, weil die Unternehmen im Revier angefangen haben, das Gewinnen von Strom aus Braunkohle zu reduzieren. Das bedeutet, dass die Arbeitsplätze in der Braunkohle nach und nach wegfallen. Deswegen müssen neue Arbeitsplätze geschaffen werden. Diese entstehen in Zusammenarbeit mit unseren Partnern aus Wirtschaft, Industrie und Wissenschaft unter anderem in unserem Cluster im Rheinischen Revier.
Wir sind noch nicht am Ziel: Wasserstoff wird heute in der Regel in zwei Zuständen zur Verfügung gestellt: entweder als mit hohem Druck (bis zu 700 bar) komprimiertes Gas oder als tiefgekühlte Flüssigkeit ( ca. -250 Grad). Genau da setzt das Helmholtz-Cluster für nachhaltige und infrastrukturkompatible Wasserstoffwirtschaft (HC-H2) an. Das Ziel in Jülich und im Rheinischen Revier ist, Grundlagenforschung zu betreiben und anschließend der Welt Speichermethoden zu zeigen, die Wasserstoff zu einem alltäglichen Energieträger oder Treibstoff machen, der ohne hohen Druck oder tiefe Temperaturen bereitgestellt werden können.
Das HC-H2 plant deswegen unter anderem Demonstrationsprojekte, die zeigen, dass die Forschungsergebnisse in der Praxis und im großen Maßstab funktionieren. Die Grundlagenforschung betreibt das Institut für nachhaltige Wasserstoffwirtschaft (INW) des Forschungszentrums Jülich. Eine Wasserstoff- Demonstrationsregion entsteht um das INW herum in der Zusammenarbeit mit den Partnern aus Industrie, Wirtschaft und Forschung. Wichtig dabei ist, dass bestehende Infrastrukturen wie Pipelines, Tankstellen oder Tanks weiter genutzt werden können.
Mit dem Thema Infrastrukturkompatibilität zielen wir auf die Umsetzungsgeschwindigkeit. In den meisten Fällen ist der Aufbau neuer Infrastrukturen zeitraubender als die eigentliche Technologieentwicklung. Wenn es uns mit unseren neuen Technologien gelingt, grünen Wasserstoff in bestehenden Gasleitungen, insbesondere aber auch in der bestehenden Infrastruktur für flüssige Energieträger, also Tankschiffe, Tankwagen, Tanklager zu handhaben, wo wir ja in Zukunft keine fossilen Mineralölprodukte mehr haben wollen – dann können wir die Energiewende hier in Nordrhein-Westfalen, aber auch in Europa und der Welt deutlich beschleunigen.